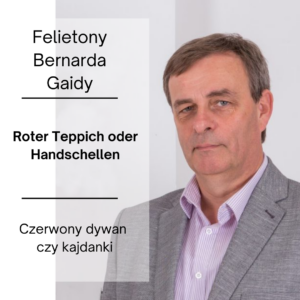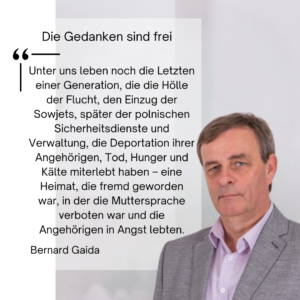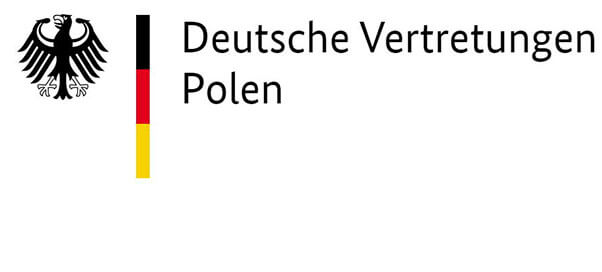Letzte Woche fand ein wichtiges Treffen der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der nationalen und ethnischen Minderheiten statt. Dies ist nicht nur deshalb wichtig, weil es die erste Sitzung dieses Gremiums im Jahr des 20. Jahrestages des „Gesetzes über nationale und ethnische Minderheiten und über die Regionalsprache“ war, sondern auch, weil wir im feierlichen Teil dieser Sitzung von Minister Tomasz Szymański die nachdrückliche Zusicherung hörten, dass mit der Vorbereitung einer Änderung des Gesetzes begonnen werde. Das ist bereits die zweite wichtige Erklärung zu diesem Thema nach der Februar-Konferenz im polnischen Sejm. Und das ist gut so, denn im Dezember habe ich auf einer Konferenz in Białystok anlässlich des aktuellen Jubiläums nicht nur in meinem eigenen Namen gesagt: „Als Bürger Polens wollen wir, dass das Land, in dem wir leben, sich an den Besten orientiert und nicht umgekehrt, und in diesem Zusammenhang betrachte ich die Stagnation als unseren Feind.“
Jedes Jahr einer nicht bedarfsgerechten Schulbildung führt dazu, dass Hunderte, wenn nicht gar Tausende Kinder weitgehend oder gänzlich die Chance verlieren, ihre Identität zu bewahren. Seit vielen Jahren, unter anderem in der Publikation zum 15-jährigen Jubiläum mit dem Titel „Identität. Kultur. Gleichheit“ unter der Redaktion von Prof. Cezary Obracht-Prądzyński, habe ich über das vergeudete Potenzial dieses Gesetzes geschrieben und gesprochen, da Polen trotz seiner Verabschiedung dieses Gesetzes im Rahmen der Umsetzung internationaler Verpflichtungen zum Schutz von Minderheiten und insbesondere ihrer Sprachen negative Bewertungen vom Europarat erhält. Der einzige Versuch einer positiven Änderung des Gesetzes endete mit einem Veto von Präsident Andrzej Duda. Aus diesem Grund freue ich mich über diese Erklärungen aus verschiedenen Machtzentren, doch als Praktiker bin ich besorgt über ihren Umfang. Manche verstehen unter der Gesetzesänderung lediglich die Aufnahme der schlesischen Sprache, andere die Sicherstellung einer unabhängigen administrativen und rechtlichen Unterstützung der Minderheitenseite in der Gemeinsamen Kommission und wieder andere eine konsequentere Umsetzung des Paragraphen zur zweisprachigen Beschilderung. Dabei hat diese Medaille zwei oder mehr Seiten.
Einerseits haben die Vertreter nationaler Minderheiten im Herbst in ihrer „Eröffnungsbilanz“ ein Paket notwendiger rechtlicher und administrativer Änderungen vorgelegt, der VdG hat ein umfassendes Positionspapier „Der Weg in eine sichere Zukunft der deutschen Sprache“ zur Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Polen im Jahr 2022 erarbeitet, und andererseits wissen wir, dass es zur Überwindung der Stagnation nicht immer einer Gesetzesänderung bedarf. Ein Beispiel hierfür wären zweisprachige Namen, deren Umsetzung sich auf Ortsnamen und Ortsschilder beschränkt. Das Gesetz erlaubt jedoch seit 20 Jahren die Verwendung zweisprachiger Namen für Straßen und alle physiografischen Objekte, beispielsweise Seen, Flüsse oder Berge. Da es sie nicht gibt, sollte man vielleicht einige Motivatoren einführen und die Atmosphäre ändern? Andernfalls wird möglicherweise auch die Änderung nichts nützen. Daher ist es gut, dass angekündigt wurde, ein Team unter Beteiligung von Minderheitsvertretern zu bilden, das einen Änderungsentwurf erarbeiten soll. Anschließend muss dieser an die Parlamentsabgeordneten, Senatoren und schließlich an den Präsidenten weitergeleitet werden. Ein schwieriger Weg.
Bernard Gaida