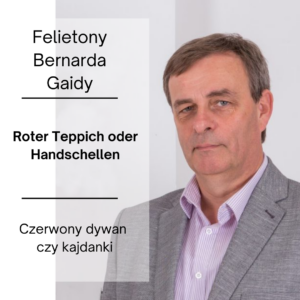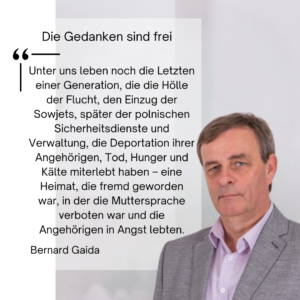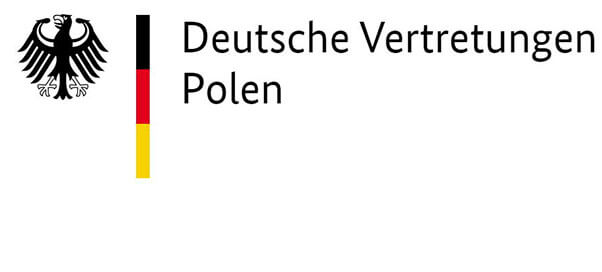„Pauline … ist Deutsche, aber sie kann sich nichts zuschulden kommen lassen und sieht keinen Grund, die Partisanen zu fürchten. Am 8. Mai 1945 rückt die erste jugoslawische Brigade in die Stadt ein. Verhaftungen und Hinrichtungen beginnen. Ohne ein Gericht und ohne ein Urteil. Für Pauline ist es zu spät, um irgendwo Zuflucht zu suchen. Ihr Elternhaus wird zur Todesfalle. Pauline stirbt am 24. August 1945 im Lager in Hrastovec (…) bei Maribor. (…) Pauline konnte die brutale Behandlung nicht überstehen und starb im Lager. (…) Ana Knez hat mit eigenen Augen gesehen, wie Menschen erschossen und dann irgendwo verscharrt wurden. (…)
Wo immer Sie bei uns graben, werden Sie Knochen finden. (…) Später wurden Massenerschießungen durchgeführt, die Opfer wurden in Bussen mit verhangenen Fenstern oder in abgedeckten Lastwagen zum Friedhof gebracht und dort erschossen, sagt Jože Maček, der das mit eigenen Augen gesehen hat. Dort wurden die Leichen in tiefe Bombenkrater geworfen. Sie wurden nie exhumiert und liegen dort bis heute“. Wenn wir die jugoslawischen Ortsnamen und die Informationen über die dortigen Partisanen ersetzen, könnten wir dies als eine weitere Beschreibung von Ereignissen in Oberschlesien, in der Nähe von Oppeln oder Beuthen betrachten.
Unterdessen sind dies Auszüge aus einem Buch des kürzlich verstorbenen Martin Pollack, „Die Frau ohne Grab: Bericht über meine Tante“, die in Slowenien, genauer gesagt in der multikulturellen Untersteiermark, lebte. Der Grund, warum ich heute daraus zitiere, ist, dass ich letzte Woche an einer Online-Diskussion über die deutsche Minderheit in Slowenien teilgenommen habe. Dies ist die einzige deutsche Volksgruppe in der Europäischen Union, die nicht als nationale Minderheit anerkannt ist. In dieser Diskussion habe ich betont, dass dies in dem Jahr, in dem sich diese Ereignisse zum 80. Mal jähren, besonders schmerzlich ist. Und sie endeten nicht mit 1945!
In ganz Jugoslawien wurden fast 167.000 einheimische Deutsche in Lagern interniert, von denen 48.500 nicht überlebten. Bis zu 26.000 Frauen, 17.000 Männer und 5.500 Kinder. Die Sterblichkeitsrate lag, fast genau wie im schlesischen Lamsdorf oder Schwientochlowitz, bei 29 Prozent. Die meisten Opfer waren verhungert. Unsere Landsleute, Jan Scheller oder Urška Kop, schilderten anschaulich die Geschichte dieser Volksgruppe, ihre Gegenwart und die Einzigartigkeit ihrer Dialekte, die auch dieses Land seit dem 10. Jahrhundert kontinuierlich geprägt haben. Mit der Ablehnung soll der Eindruck erweckt werden, dass die deutsche Kultur und Sprache in diesem Land ein Fremdkörper und ein eingewanderter Faktor ist.
Auch wenn die deutsche Minderheit in Polen anerkannt ist und die Multikulturalität auf jede erdenkliche Weise deklariert wird, spüre ich viele Ähnlichkeiten zwischen uns und dem fernen Slowenien. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehört auch das Schicksal der Deutschen im Nachkriegsschlesien, Pommern, Ermland oder Masuren. Dort spielte sich die gleiche Nachkriegstragödie der Bevölkerung deutschen Geistes ab wie bei uns. Martin Pollack hätte auch über die einheimische Bevölkerung im polnischen Schlesien schreiben können, dass unter dieser Bevölkerung „Angst und Misstrauen herrschten“. Diese Angst in Schlesien war nicht anders als die Angst im Ermland, in Masuren, in der Tschechoslowakei, in Rumänien oder eben in Jugoslawien.
Bernard Gaida