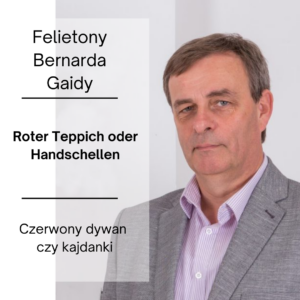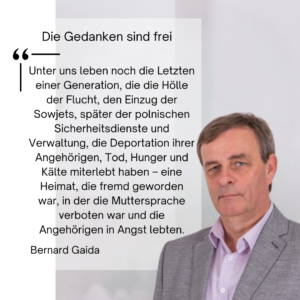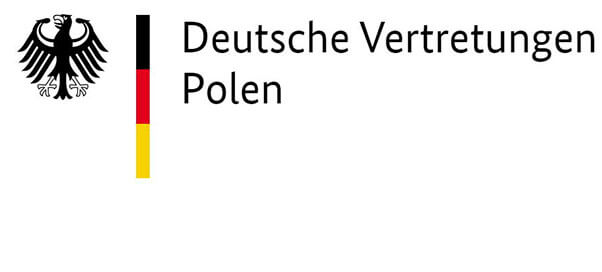„Halina hätte es vorgezogen, wie jeder in Waldenburg, ein deutsches Haus mit Garten in Weißstein oder Bad Salzbrunn zu bewohnen, wo die neuen Hausbewohner unter den Büschen ganze Küchengarnituren mit der Aufschrift „Bayern“ an der Unterseite ausgruben, auch heilige Figuren mit Münzen, Bestecke und Standuhren, die noch gingen, und nach dem Regen streckten Porzellantänzerinnen und Hirtinnen selbst ihre weißen Hände und Füße aus der Erde, um gefunden zu werden. (…) Und am Anfang haben sie alle gegraben, nur eben nicht Kartoffeln. Sie haben den ganzen Hof aufgerissen auf der Suche nach dem, was die Deutschen vergraben hatten. Und jeder grub in seinen Gedanken etwas anderes aus. Ein silbernes Besteck, das eine Großmutter aus der Nähe von Sambor ihrer Enkelin schenken sollte, aber sie schaffte es nicht und vergrub es im Garten, damit es nie wieder ausgegraben wurde. Dort Vergrabenes hier auszugraben – das wäre ja nur fair. (…)
Zuerst eilten sie zum Schloss Fürstenstein, denn es ging das Gerücht um, die Deutschen hätten dort die Bernsteinkammer versteckt. Also rissen sie die Böden und Wände ein, bissen sich in die Stuckdecken hinein, zwei ertranken im Schlossbrunnen, einer blieb in einem Abwasserrohr stecken, aber sie fanden nichts. (…) Einmal kamen die Deutschen uneingeladen nach Polen und sechs Jahre lang wurde man sie nicht los, und jetzt bittet man sie, wenigstens für eine Weile zurückzukommen und Kasia, Madzia oder Bożenka zu heiraten. (…) Die Deutschen haben angeblich den Krieg verloren, sie haben so viele Menschen ermordet, und jetzt haben sie Supermärkte, Otto-Kataloge und Dosengetränke, während die Sieger Schnitzel aus Brotkrumen und gehackter Mortadella machen“.
Diese ausführlichen Auszüge von Joanna Bator stammen aus dem Roman „Piaskowa Góra“, der 2009 in Polen und nur zwei Jahre später in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Sandberg“ erschienen ist. Auf diese Weise hat die Autorin jenem Waldenburger Hügel indirekt seinen nach 1945 verlorenen deutschen Namen zurückgegeben. Vor allem aber zeigte sie die Besonderheit Waldenburgs in der Nachkriegszeit auf, die ich aus den Erzählungen meines Onkels kannte, der vor einigen Jahren im sächsischen Lugau starb. Dorthin war Hans-Joachim mit seiner Mutter und seinem Bruder gekommen, als er Ende der 1950er Jahre aus Waldenburg, genauer gesagt aus Niedersalzbrunn, vertrieben wurde. Polnische Historiker bezeichnen dies durchweg als Aussiedlung. Er aber fühlte sich vertrieben von seiner Heimat, von seiner deutschen Schule in Waldenburg, von seinen auch polnischen Freunden, mit denen er Fußball spielte, und betrogen.
Er sagte, wenn die Deutschen schon gelernt haben, in der Stadt zusammen mit den Polen zu leben, warum hat man sie dann mehr als 10 Jahre nach dem Krieg weggeschickt. Sachsen wurde nicht seine Heimat, sondern eher seine Stiefmutter. Für seine künftige Frau ging er nach Oberschlesien. Sie musste eine Schlesierin sein. Die Autorin stellte dieses und ihre anderen Bücher letzte Woche im Haus des Deutschen Ostens in München vor. Das Publikum bestand hauptsächlich aus in Deutschland lebenden Schlesiern, die sich nach jedem Wort und jedem Bild von Schlesien sehnten. Wie ein roter Faden zieht sich durch den Roman die Wahrheit, dass wir alle in Schlesien eine Gemeinschaft des verlorenen Landes sind, sei es geografisch oder kulturell.
Bernard Gaida